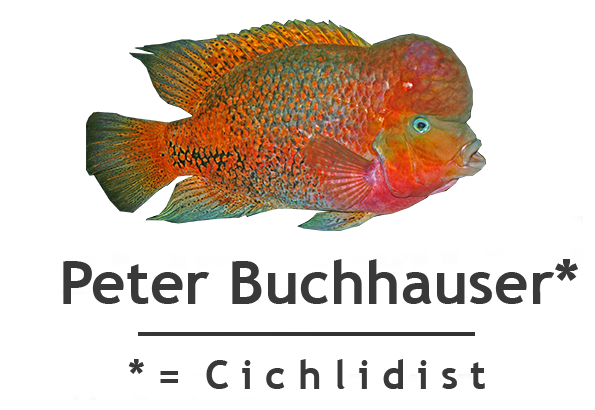"...Wir saßen in einer betagten Boeing 737 und warteten auf unsere Landung in Iquitos..." Peter Buchhauser
Startpunkt der Reise in La Paz, der Hauptstadt Boliviens, dann Richtung Norden über die Grenze nach Peru zum Titicacasee und weiter nach Cuzco, der einstigen Inka-Hauptstadt. Vier Tage Wanderung zur weltberühmten, geheimnisumwitterten Inkastätte Machu Picchu. Über Arequipa weiter an die trockenheiße Küste. Die rätselhaften Nazca-Linien mitten in der Wüste und die alten Pisco-Kulturen auf der Paracas-Halbinsel sollten weitere Punkte auf der Strecke Richtung Norden sein. Von Perus Hauptstadt Lima dann weiter in den feuchtwarmen Regenwald bei Iquitos und anschließend über die Nordküste wieder nach Lima zurück. Dies war unsere geplante Route für einen vierwöchigen Rucksack-Trip in Südamerika.
Nachdem ich bereits dreimal Buntbarsche und Welse aus Zentralamerika mit nach Deutschland gebracht htte, entschloß ich mich diesmal definitiv dazu, nichts nach Hause zurückzunehmen. Wir hatten keinen Mietwagen und durch unsere normale Ausrüstung war der Rucksack ohnehin randvoll. Es blieb also kein Platz mehr für Netze, Membranpumpen, Schläuche, Tüten, etc. Trotzdem wollte ich mir das Flußparadies um Iquitos am Oberlauf des Amazonas nicht entgehen lassen.
Mein Arbeitskollege, der sich als Einziger für diese Tour richtig begeistern konnte, hat zwar mit Aquaristik nichts am Hut, ist jedoch ein erstklassiger Hobbyfotograf und ein zuverlässiger Begleiter. Es hatten sich also zwei Traveller gefunden.
Um es gleich vorwegzunehmen: Die gesamte Reise hat sich sehr gelohnt und dadurch, daß man nicht ständig darauf aus war, Cichliden zu fangen, wurde speziell der Amazonas-Teil der Reise sehr angenehm und erholsam. Was nützt es, Unmengen von Jungfischen mitzunehmen, wenn alle Aquarien bereits voll sind und die Tiere dann zwei Monate später wieder verschenkt werden müssen. Lieber nur fotografieren, hieß diesmal meine Devise.
Wir saßen in einer betagten Boeing 737 und warteten auf unsere Landung in Iquitos. Unter uns schlängelten sich durch den hier noch undurchdringlich scheinenden Regenwald (Gott sei Dank ist noch nicht alles abgeholzt!) zahllose kleinere Zuflüsse dem Amazonasoberlauf entgegen. Es war interessant zu sehen, wie durch eine Unzahl von Windungen selbst Miniflüsse auf beträchtliche Längen kommen, bis sie in einen größeren Fluß einmünden. Bereits beim Landeanflug stellten mein Reisebegleiter und ich fest, daß bald ein tropischer Regen niedergehen wird. Dieser Regen, bemerkten wir sehr bald, war eine tägliche, fast zur gleichen Zeit wiederkehrende, willkommene Abfrischung.
Während bei uns in Deutschland Schneematsch und Eisglätte herrschten, hatten wir zur gleichen Zeit in Iquitos mindestens 30 °C Lufttemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von vielleicht 95 Prozent. Beim Verlassen der Gangway glaubten wir, erst einmal gegen eine unsichtbare Wand gelaufen zu sein. In kürzester Zeit waren wir völlig durchgeschwitzt. Kurz darauf setzte auch der zuvor erwartete heftige, aber kurze Tropenregen ein. Mittlerweile waren wir an Regen gewöhnt, hatte es doch auf dem gesamten Inkaweg bis Machu Picchu vier Tage lang geregnet.
Nachdem wir uns eine passable und trotzdem günstige Unterkunft gesucht hatten, machten wir uns auf den Weg, die kulinarischen Köstlichkeiten des Amazonas kennenzulernen. Auf einigen Speisekarten wurde Paiche (Arapaima gigas) angeboten. Natürlich hatten wir nicht im Sinn, den ohnehin in seinen natürlichen Beständen bereits stark dezimierten Riesenfisch, der unter Artenschutz steht, zu verspeisen. Um so mehr freute es uns, daß wir auf unsere nachdrückliche Frage nach Paiche gleich die höfliche, aber bestimmte Antwort bekamen, daß dieser Fisch unter Naturschutz steht und deswegen nicht mehr serviert wird. Ein paar Tage später konnten wir uns jedoch vom Gegenteil überzeugen, als amerikanische Touristen neben uns ein paar Geldscheine locker machten, um eben gerade Paiche trotz des Schutzes aufgetischt zu bekommen. Es bestätigte sich auch in Iquitos wieder das, was wir selbst in Puno erlebten: Mit Geld läßt sich alles machen. Dort konnte man uns überaschenderweise mitten in der Nacht doch noch zwei Fahrkarten für den Zug nach Cuzco besorgen, obwohl dieser bereits am Nachmittag völlig belegt war. Allerdings mußten wir auch dazu ein wenig nachhelfen...
Am nächsten Tag, nachdem wir uns nochmal richtig den Bauch mit einer großen Portion Dorado (Brachyplatystoma spec.) gefüllt hatten, machten wir uns mit einem Aluboot auf den Weg zu einer Urwaldlodge. Etwa 55 km stromaufwärts bogen wir in den Rio Tamshiyacu ein und erreichten wenige Kilometer später unser Ziel, welches uns für die nächsten vier Tage als Unterkunft und Ausgangspunkt für unsere Ausflüge dienen sollte. Wir hatten dies erst am Vortag über einen lokalen Veranstalter arrangiert und freuten uns darüber, daß wir die einzigen Gäste der Lodge waren und so einen Führer für uns alleine hatten.
Es ist schon erstaunlich, was sich mitten im Regenwald alles unternehmen läßt. Tages- und Nachtwanderungen, Besuch eines Indianerdorfes, Einbaumfahrten und natürlich Fischen. Schließlich wollte ich unbedingt mein Mittagessen wenigstens einmal selbst fangen. Wir wurden wirklich sehr gut verpflegt und es erstaunte uns, mit welch einfachen Zutaten hier leckere Gerichte zubereitet wurden.
Bei einer unserer Tageswanderungen stellten wir leider auch sehr besorgniserregende Tatsachen fest. Mitten im dichten Tropenwald standen wir plötzlich vor einer kleinen erst kürzlich gerodeten Lichtung. Im Zentrum dieser befand sich das abgeholzte Holz fein säuberlich zu einem Meiler aufgeschichtet. Durch Abbrennen unter weitgehendem Luftabschluß gewinnt man dadurch Holzkohle. Wenige Minuten später kamen wir zu einer kleinen Ansiedlung und fanden gleich das Resultat eines anderen Meilers: 57 Säcke voll mit Holzkohle, die nach Aussage der Besitzerin ca. 2 Monate Arbeit einschließlich Rodung per Machete erforderten. Auf dem Markt von Iquitos würde für die gesamte Menge ein Verkaufspreis von umgerechnet rund 120.- DM erzielt werden. So verschwindet ein Stück Tropenwald nach dem anderen, auch wenn hier nicht mit massiven Waffen (Motorsäge und Bulldozer) gegen die Natur vorgegangen wird. Dennoch höhlt bekanntlich steter Tropfen den Stein!
Am nächsten Tag versuchten wir uns beim Angeln. Hinter unserer Lodge, die direkt am Rio Tamshiyacu lag, befand sich eine kleine Lagune, die nur bei Hochwasserstand eine direkte Verbindung zum Fluß hat. Während der Fluß wegen seiner mitgeführten Sedimente die gleiche dreckig-braune Trübung aufwies wie der Amazonas selbst, konnte man das Wasser der Lagune durchaus als Schwarzwasser betrachten. Eine gewisse - wenn auch begrenzte - Tiefensicht war hier möglich, das ganze Gewässer lud einfach zum hineinspringen ein. Jedoch zogen die Einheimischen den Fluß vor. Warum? Piranhas! Angeblich sei es völlig gefahrlos, im Weißwasser Baden zu gehen, während niemand freiwillig in ein Schwarzwasser geht. Wir selbst folgten dem Rat und versuchten, uns bei fast 30 °C Wassertemperatur etwas abzufrischen. Lange hielten wir es aber nicht aus, zu unheimlich und zu unsicher war uns die trübe Brühe.
Täglich suchten wir unser Glück beim Angeln mit den unterschiedlichsten Ködern. Außer Scheibensalmlern (Myleus spec.), Dornwelsen (Doras spec.) und handlangen Antennenwelsen (Pimelodus spec.) konnten wir aus dem Fluß nichts an Land ziehen. Nicht gerade ein berauschender Erfolg für ein angeblich fischreiches Gebiet.
Meist fuhren wir auf einem wackeligen Einbaum das Ufer der Lagune entlang. Zwar wurden unsere Hühnerfleischbrocken, die wir an die Angelhaken gehängt hatten, mehrmals innerhalb kürzester Zeit heruntergerissen, trotzdem konnten wir nicht einen Piranha zu sehen bekommen. Vom besagten Fischreichtum des Amazonas keine Spur. Trost spendete uns nur die üppige Vegetation, die fast immer in gigantischen Ausmaßen wie z.B. in wunderschönen Riesenseerosen (Victoria amazonica) zu sehen war.
Viel zu schnell vergingen die vier Tage auf der Lodge. Aber wir hatten uns richtig erholt von unserem straffen Programm und von der automobilen Hektik in Perus Hauptstadt.
Wieder in Iquitos angelangt, statteten wir dem örtlichen Zoo einen Besuch ab. Leider war dies wirklich das Jämmerlichste, was ich je in einem zoologischen Garten gesehen habe. Andere Länder, andere Verhältnisse, werden nun einige sagen. Das mag sein, aber daß es auch anders geht, zeigte mir der geradezu vorbildliche Zoo in Belize. Während dort der seltene Tapir als Nationaltier gilt, wird in Peru dieses Tier gnadenlos gejagt, am Markt verhökert und anschließend gegrillt verspeist.
Mich interessierte in erster Linie das Aquarium im Zoo von Iquitos. Obwohl neben einigen Aquarien Bilder von Skalaren und Diskusfischen hingen, befanden sich in diesen Becken lediglich asiatische Fadenfische. Ein einziger Arapaima von vielleicht 20 cm Länge und drei halbverhungerte, verpilzte Tucunares (Cichla spec.) ließen den Schluß zu, daß man am Amazonasgebiet ist. Sämtliche Becken wurden weder durchlüftet noch gefiltert.
Am nächsten Tag - es war unser letzter in Iquitos - statteten wir dem Ortsteil Belen (nicht zu verwechseln mit Belem in Brasilien) einen Besuch ab. In unserem Reiseführer hatten wir gelesen, daß manche Belen für das Venedig Südamerikas halten, andere wiederum sehen darin schlicht und einfach die größten schwimmenden Slums des Kontinents. Schwimmend aus den Grund, weil dort viele der Bauten auf Flößen errichtet wurden, um mit den Wasserspiegelschwankungen des Amazonas auf- und abzugehen. Die weiter vom Ufer entfernteren Holzhütten wurden als Pfahlhäuser gebaut.
Uns interessierte weniger der "Hauch von Venedig", noch wollten wir die mitleiderregenden Slums begutachten. Vielmehr wollten wir in Belen den Markt von Iquitos sehen, denn spätestens seit Cuzco wußten wir, daß auf diesen Märkten alles angeboten wird, was sich irgendwie verkaufen läßt. Wenn wir schon wenig Glück beim Angeln hatten, so wollten wir doch sehen, was der Amazonas an Fischen hervorbringt.
Ob geschützt oder nicht, getrocknetes Fleisch vom Arapaima gab es dort massenweise zu kaufen. In geflochtenen Körben lagen unzählige Harnischwelse der Gattungen Glyptoperichthys, Hypostomus und Pterygoplichtys, die noch lebten und langsam in der Mittagssonne verendeten, nachdem ihnen bereits zuvor mit einer Machete die wehrhaften Brustflossen abgeschlagen wurden. Von den vielen Vertretern der Antennenwelse (Pimelodidae) konnten wir nur wenige Pseudoplatystoma spec. und einige Sorubim lima entdecken. Wirklich groß waren sie alle nicht. Exemplare von über ein Meter Länge, wie wir sie in unseren zoologischen Gärten finden, gab es nicht. Vermutlich ein Hinweis auf Überfischung. Neben weiteren Welsen aus der Verwandtschaft der Dornwelse zierten vor allem Salmler wie Pacus und Scheibensalmler die Verkaufstische. Die einzigen Buntbarsche, die wir vorfanden, waren mittelgroße Astronotus in häufiger Anzahl und wenige Caqueteia spectabilis. Insgesamt nicht sehr beeindruckend, wir hatten gedacht, hier viel mehr Arten antreffen zu können.
Jedoch gab es außer Fischen viele andere Verkaufsobjekte", die unsere Blickfänge auf sich zogen: Land- und Wasserschildkröten, 10 cm bis 60 cm lang, wurden entweder ganz oder portionsweise für Schildkrötensuppe verkauft. Lebende Kleinkrokodile konnten für umgerechnet 5.- DM erworben werden. Was der Endverbraucher allerdings mit lebenden Fröschen macht, konnten wir nicht herausfinden. Die faustgroßen Schnecken beeindruckten uns sehr, aber über die weitere Verwendung wollten wir nicht weiter nachdenken. Tapire wurden wie Schweine zerlegt und verkauft. Papageien saßen eingepfercht in winzigen Käfigen, etc.
Nun mag dies alles vielleicht zu sehr als Anklage gegen diese Sitten verstanden werden. Dem ist aber nicht so. Wir Europäer regen uns unweigerlich darüber auf, wenn wir sehen, wie dort mit geschützten Tieren umgegangen wird. Solange wir jedoch Flugtickets kaufen, die vielleicht den Jahreslohn eines dortigen Händlers darstellen, dürfen wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf diese Leute deuten, die damit ihren dürftigen Lebensunterhalt verdienen müssen. Kaum jemand von uns weiß am Morgen nicht, was er am Abend zu Essen hat. Dort aber kennen die Menschen den Begriff Hunger sehr wohl und deshalb kann man es ihnen nicht verübeln, wenn für diese Menschen Naturschutz ein Fremdwort ist.
Download des Artikels (pdf)
© Peter Buchhauser